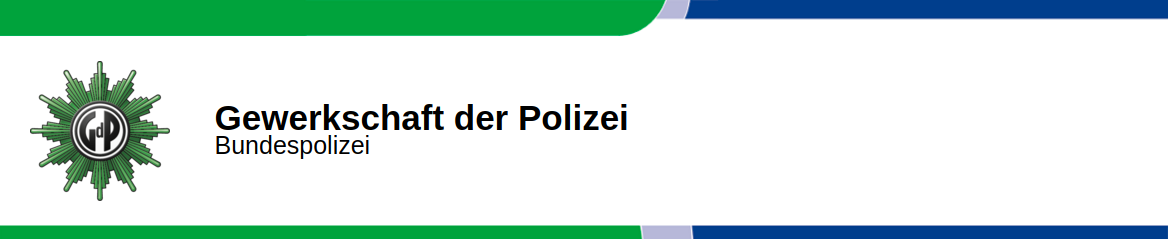„Lohn und Macht” – Ein Kommentar von Detlef Esslinger
Sechseinhalb Prozent mehr Geld in der Metallindustrie? Völlig in Ordnung, werden viele Menschen denken. Sechseinhalb Prozent im öffentlichen Dienst? Maßlos.
Erschienen in: Sueddeutsche Zeitung. Freitag, 10. Februar 2012.
Es beginnt nun die Zeit, da für Millionen Arbeitnehmer die Löhne neu verhandelt werden, und wer sich umhört, der erfährt das Erwartbare: Die Forderung, die die IG Metall stellt, gilt schon deshalb als völlig angemessen, weil die Unternehmen im vergangenen Jahr richtig gut verdient haben und nach der Krise nun endlich die Arbeitnehmer an der Reihe sind. Jene gleiche Steigerung aber, die Verdi und der Beamtenbund von Bund und Kommunen verlangen? Die Talkshow „Anne Will“ hatte am Mittwochabend das wohlgesetzte Thema: „Deutschland, deine Beamten – überversorgt und überflüssig?“, was natürlich eine sich selbst beantwortende Frage sein sollte. In dem Einspielfilm zu Beginn bekamen Passanten die Frage gestellt, ob Lehrer denn unbedingt Beamte sein müssten. DieAntworten: „Die sollen ihre Pflicht tun, das muss man in anderen Berufen auch.“ – „So ’ne Verbeamtung führt doch zu so ’ner Verkrustung.“ Die Moderatorin stellte, beifallssicher seufzend, fest, dass die Beamten „wieder mal“ mehr Geld wollten. So denkt die Mehrheit im Land: Beim Staat hat man es den ganzen Tag schön warm, was braucht man da noch mehr Geld?
Gewerkschaften und Arbeitgeber laden Lohnverhandlungen gern mit großartigem Getue auf: Die einen sagen dann, man stehe in der Verantwortung, die Binnennachfrage anzukurbeln; die anderen warnen davor, den Firmen solche Kosten aufzubürden, dass die Konjunktur unweigerlich zugrunde gehe. Beim Laien mag das zu dem Eindruck führen, in Tarifgesprächen werde das ökonomisch Sinnvolle ausgelotet, das Ergebnis sei von einer gewissen Weisheit getragen. Das ist aber nur insofern richtig, als ökonomische Kennziffern – Auftragseingänge, Umsatzrenditen, Etatdefizite – den groben Rahmen für die Gespräche liefern.
Am Ende jedoch sind Machtverhältnisse entscheidend. Wo die Gewerkschaften viele Mitglieder haben und eine gewisse gesellschaftliche Rückendeckung verspüren, da setzen sie viel durch.
Deshalb kann die IG Metall mit gewissem Optimismus verhandeln; ebenso die IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), die nächste Woche ihre Forderungen umreißt. Für Verdi hingegen ist es meistens schon ein Erfolg, im Öffentlichen Dienst die Reallöhne (also nach Abzug der Inflationsrate) halbwegs stabil zu halten. Die Kassen von Bund und Kommunen sind bekanntlich immer leer; das nicht vorhandene Geld geben Politiker viel lieber für Steuersenkungen als für ihre Beschäftigten aus. Letzteres würde ihnen von den Wählern nie honoriert. Wenn Verdi nun eine Forderung in derselben Höhe wie die IG Metall erhebt, ist das soziologisch ein recht spannendes Experiment.
In Wahrheit sind die Gewerkschaften nur in wenigen Branchen stark. Statistiken, nach denen 2011 in Deutschland „die“ Reallöhne gestiegen sind, führen in die Irre. Die Zahl ist eine Durchschnittszahl, im wesentlichen geht sie auf Erfolge von zwei Gewerkschaften zurück, der IG Metall und der IG BCE. Stahl und Chemie, Metall und Elektro, dort lässt sich noch etwas durchsetzen – nicht zuletzt deshalb, weil mehr als die Hälfte der Beschäftigten organisiert sind.
Oft aber sind Gewerkschaften schon froh, wenn sie verhindern, dass sich die Beschäftigungsbedingungen verschlechtern. Die Zeiten, in denen eine Branche mit ihren Tarifen die Funktion einer Lokomotive übernahm, die die anderen mit sich zog, sind längst vorbei. Im Gegenteil, nachdem es mit der Konjunktur immer schneller und heftiger auf und ab geht, müssen auch die Erfolg gewohnten Gewerkschaften sich neu sortieren: Die IG Metall will nun auch versuchen, per Tarifvertrag die Leiharbeit einzudämmen; aus Sorge, dass andernfalls die Löhne der Stammbelegschaft unter Druck geraten. Ob ihr das gelingt, ist offen – und ebenso, ob ein Erfolg denn irgendetwas nützen würde: Ein Personalchef, der Stammbeschäftigte nicht einstellen will und Leiharbeiter nicht länger einstellen darf, weicht eben auf Werkverträge aus. Das Wasser findet seinen Weg.
Tarifverhandlungen sind derart komplizierte Veranstaltungen, dass ein großer Teil des Publikums sie mit diffusen Vorstellungen von Gerechtigkeit verfolgt. Denn wer bedenkt ernsthaft, dass die Metallindustrie ebenso ein Opfer von zockenden Bankern war wie Arbeiter? Wenn ein Kunde eines Anlagenbauers keinen Kredit mehr bekommt, kann er die Anlage nicht kaufen. Und wer „den Beamten“ mehr Geld missgönnt, hat wahrscheinlich irgendwelche Ärmelschoner vor Augen, keinesfalls aber Bundespolizisten und Feuerwehrleute. Und schon gar nicht bedenkt der Talkshow-Zuschauer, dass in Tarifverhandlungen allenfalls angestellte Krankenschwestern „wieder mal“ mehr Geld wollen, nie jedoch beamtete Brandmeister. Die können nur hoffen, dass ihr Dienstherr den Tarifabschluss auf sie überträgt.
Neid ist ein schlechter Ratgeber, auch hier. Wer glaubt, seinesgleichen komme zu kurz, könnte nach kurzem Nachdenken auch zu dem Schluss kommen: Motzen bringt kein Geld – in eine Gewerkschaft eintreten, vielleicht schon.
Erschienen in: Sueddeutsche Zeitung. Freitag, 10. Februar 2012.
© Süddeutsche Zeitung GmbH, München. Mit freundlicher Genehmigung von http://www.sz-content.de (Süddeutsche Zeitung Content).
Quelle: www.gdp.de