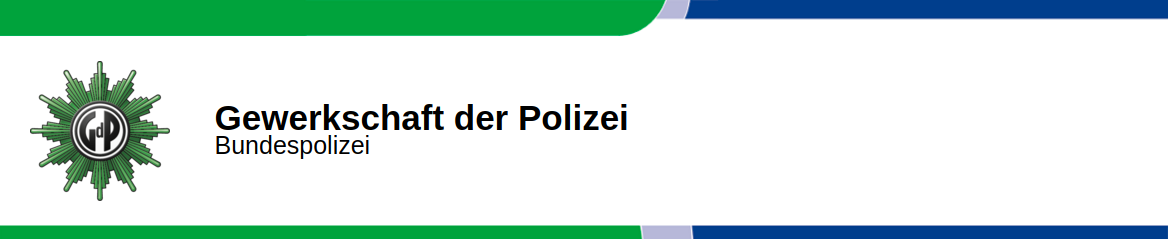Ein mehrstündiger polizeilicher Einsatz, der bei einem Polizeibeamten eine posttraumatische Belastungsstörung zur Folge hat, kann ein Dienstunfall sein. Das entschied das Oberverwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen (Urteil vom 29.08.2017 – 2 LB 36/169).
Ein mehrstündiger polizeilicher Einsatz, der bei einem Polizeibeamten eine posttraumatische Belastungsstörung zur Folge hat, kann ein Dienstunfall sein. Das entschied das Oberverwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen (Urteil vom 29.08.2017 – 2 LB 36/169).
Der Kläger war Leiter eines Sondereinsatzkommandos. Während einer Schicht wurde er zu einem Einsatz gerufen, bei dem ein Mann seine Ex-Freundin und sich selbst erschossen hatte. Die Mutter der Ex-Freundin wurde ebenfalls schwer verletzt.
Entgegen seinem ausdrücklichen Willen wurde er sodann auch bei der Betreuung der Angehörigen des Täters eingesetzt. Rund einen Monat später begab er sich in die Behandlung eines Facharztes für Psychotherapeutische Medizin, da er u.a. unter Angstzuständen, Schlaf- und Antriebslosigkeit litt. In der Folgezeit war er mehrfach dienstunfähig erkrankt und wurde im Laufe der Zeit polizeidienstunfähig. Eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) wurde durch unterschiedliche Gutachten bestätigt.
Der Dienstherr lehnte die Anerkennung eines Dienstunfalles mit der Begründung ab, dass kein Dienstunfall im Sinne des Beamtenrechts vorliege. Dieses setzt ein durch äußere Einwirkung beruhendes, plötzliches, örtlich und zeitlich bestimmbares Ereignis voraus, das einen Körperschaden verursacht hat (vgl. § 31 BeamtVG). Weiter wurde auch die PTBS nicht als anerkannte Berufskrankheit anerkannt, da der Polizeibeamte, anders als andere Beamte psychisch belastbarer zu sein habe.
Dieser Ansicht schloss sich das Verwaltungsgericht in 1. Instanz an. Es führte u.a. aus, dass bereits kein plötzliches Ereignis vorgelegen habe, sondern lediglich eher eine über Stunden anhaltende dienstliche Stresssituation gegeben gewesen sei. Eine anzuerkennende PTBS setze voraus, dass eine unmittelbar lebensbedrohliche Situation für den Beamten selbst oder jedenfalls bei einer nahestehenden Person bestanden haben müsste, um das Merkmal des äußeren Einwirkens zu erfüllen. Im Fall des streitigem Einsatz wären jedoch diversere Belastungsmomente zu verzeichnen gewesen und kein abgrenzbares Einzelgeschehen.
Das OVG hob die Entscheidung jedoch auf und stellte fest, dass sehr wohl eine äußere Einwirkung im Sinne des Gesetzes vorliege, da es ausreiche, dass die Krankheit durch äußere Umstände entsteht. Eine physikalische Einwirkung auf den Körper sei nicht erforderlich. Abzugrenzen sei allein von den krankhaften Vorgängen im Inneren des menschlichen Körpers, die auf besondere Veranlagung oder willentliches Verhalten des Beamten zurückzuführen seien. Beim Kläger konnten jedoch keine solchen Besonderheiten erkannt werden.
Auch habe es sich um ein „plötzliches“ Ereignis gehandelt. Das Merkmal diene allein der Abgrenzung eines Einzelgeschehens zu dauerhaften Einwirkungen. Das Unfallgeschehen muss unvermittelt eintreten und sich in einem relativ kurzen Zeitraum ereignen und wirken. Dabei sind auch Geschehen anerkannt, die eine Dauer von mehreren Stunden erfüllen. Entsprechend der bereits bestehenden Rechtsprechung ist ein Zeitraum von einer Arbeitsschicht ausreichend. Das Gericht erkannt auch die nachgewiesene PTBS als Körperschaden an und bejahte die Kausalität. Die PTBS sei nach dem Diagnoseschlüssel eine verzögerte oder protrahierte Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer Dauer, mit außergewöhnlicher Bedrohung der katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde.
Source: RSS aus GdP Bundespolizei